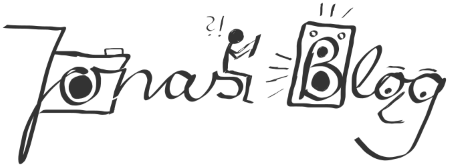Faktenbasierte Forschung ist oft genau das Gegenteil von kreativer Kunst. Dass es auch anders geht, haben einige Forschungszentren der TU Chemnitz und eine Vielzahl Künstler:innen aus Leipzig nun im Rahmen des Programms der Kulturhauptstadt Europas 2025 bewiesen. Sie kreierten in Workshops wunderschöne Werke, die begeistern und zum Nachdenken anregen. Ein Überblick über die technologisch-künstlerischen Ergebnisse im Funken-Space in der Rosenbergstraße.
MAIN: Zwischen Licht- und Schallwellen
Wohl keine Naturwissenschaft ist in der Kunst so relevant wie die Physik. Schließlich sehen und hören wir erst durch physikalische Prozesse. Am Forschungszentrum MAIN der TU Chemnitz fand deshalb der Workshop “Von Nano zu Kunst: Physik als experimentelles Material” unter der Leitung der Künstlerin Sanja Star statt. In der Einrichtung, deren Wissenschaftler:innen Materialien, Architekturen und die Integration von Nanomembranen (kurz MAIN) untersuchen, entstanden unter dem Titel „From Nano To Art“ einige technisch inspirierte, audiovisuelle Kunstwerke.
Eines davon stammt von Christopher Schröder. Er wandelt in seinem „Lichtbild“ mithilfe einer Polarisationsbrille eine monochrome Animation in ein buntes Farbspektakel. Kopfbewegungen verstärken den Effekt zusätzlich. Ein unwirklich anmutendes Erlebnis. Nebenan lädt Vanessa Rucks mit ihrem Werk „Layers Of Connection“ zum Nachdenken an. Das „unvollständige“ Triptychon erkundet die feinen Verbindungen zwischen Kunst, Wissenschaft und Menschlichkeit. Ultraviolettes Licht lässt eine Figur entstehen – ähnlich der mikroskopischen Struktur auf einem Wafer. Goldenes Licht sinkt herab wie leuchtender Staub, getragen von geladenen Partikeln. Die Hand entflieht der Laborumgebung. Dem streckt sich die Hand eines alten Mannes entgegen – angelehnt an das Zusammenspiel von Anode und Kathode im Inneren einer Batterie. Ein Kind blickt erwartungsvoll nach vorn. Offen für das, was noch entstehen mag.
Ähnlich unvorhersehbar ist die Entwicklung des Kunstwerks „Folding Field“ von Sanja Star. Das Projekt basiert auf Forschungen von Nanomembranen, die den autonomen „Smartlet“-Mikrorobotern zugrunde liegen. Dabei handelt es sich um ultradünne, mehrschichtige Systeme, die sich zu dreidimensionalen Mikrostrukturen entfalten. Schichten aus transluzentem Gewebe, durchsetzt mit reaktivem Licht, reagieren auf Bewegung und Nähe. Elektromagnetische Klänge erweitern die Arbeit akustisch. Um Schallwellen dreht sich auch die Installation „Untitled“ von Tim Abels. In vier Petrischalen wachsen Hefekulturen heran. Die dabei entstehende Wassertrübung wird kontinuierlich per Sensoren überwacht. Schwingungsgeber wandeln die so gewonnenen Signale in Schallfrequenzen um, denen zwei der Kulturen ausgesetzt werden.
MeTech: Wie Menschen mit Technik interagieren
Unter der Überschrift „Eliza’s Ghost – Sozialist als Simulation“ fanden Workshops unter der Leitung von Medienkünstler Lenn Blaschke am Forschungszentrum für Mensch und Technik (kurz MeTech) statt. Die Teilnehmenden untersuchten wie Roboter und KI-Systeme Sprache, Bewegung und sensorische Schnittstellen nutzen, um die Illusion von Bewusstsein und Empathie zu erzeugen. Somit verband der Workshop künstlerische Praxis und kritische Theorie zu einem gemeinsamen Forschungsraum über die Grenzen von Sozialist in Zeitalter der Simulation.
Die Videoarbeit „Not A Match“ von Rainer Winter erzählt von einem missglückten Date. Sie spielt in einer Zeit, in der Maschinen zu einer selbstverständlichen Option in der Suche nach Nähe und Gesellschaft geworden ist. Während sie immer menschlicher erscheinen, verhalten sich Menschen zunehmend wie Maschinen. Damit gewinnt die Kommunikation der eigenen Wünsche und der Respekt der individuellen Grenzen an Bedeutung.
Das wohl eindrucksvollste Exponat stammt von Lenn Blaschke und Sascha Kaden. Unter dem Titel „Untitled Brain“ scrollt ein Roboterarm kontinuierliche durch KI-generierte Videos. Halb Traum, halb digitales Fragment, flackern sichtbar gewordene synthetische Emotionen. Über allem thront ein in Harz gegossenes Gehirn. Virtuell lässt sich mithilfe einer VR-Brille in ihm spazieren, während eine am Arm montierte Kamera die Inhalte digital spiegelt. Die Installation verwandelt das philosophische „Brain-in-a-Vat“ in eine erfahrbare Anatomie des digitalen Geistes – ein Organismus, der durch seine eigene Simulation träumt.
MERGE: Aus Mehlwurmkot zum neuen Material
Besonders gespannt war ich auf die Ergebnisse des Workshops „Common Matter“ von Yana Zschiedrich am MERGE-Forschungszentrum, fanden die Arbeiten doch an meiner Arbeitsstätte statt. Dabei stand die experimentelle Verarbeitung von GEOBRIS, einem biobasierten und spekulativen Material aus Mehlwurmkot und biobasiertem Kunststoff, im Mittelpunkt. Die Teilnehmenden erforschten dessen ästhetische, technische und narrative Potenziale und entwickelten eigene Anwendungen.
Sichtbar wird die Verdichtung einer Woche gemeinschaftlicher Arbeit, in der Künstler:innen, Forscher:innen, Maschinen und Materialien miteinander in Beziehung traten. Die Skulpturen entstanden in der kurzen Zeit des aufgeschmolzenen Zustands. Sie tragen deshalb Spuren der Hitze, des manuellen Formens und Verletzlichkeit, aber auch Fragmente eines Prozesses, der unvollendet bleibt.
Entdecke mehr von Jonas’ Blog
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E‑Mail zu erhalten.