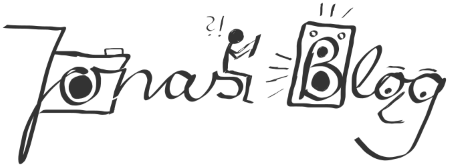Chemnitz gilt als das Tor zum Erzgebirge. Was liegt also näher als eine Ausstellung über die Geschichte des namensgebenden Bergbaus?! Im Staatlichen Museum für Archäologie in Chemnitz (kurz: SMAC) findet aktuell im Rahmen des Jahres der Kulturhauptstadt Europas 2025 eine Sonderausstellung statt. Unter dem Titel „Silberglanz und Kumpeltod“ lassen sich im altehrwürdigen Kaufhaus Schocken so manch neue Entdeckungen machen. Ich war mit der Kamera unterwegs.
Wissenswertes über den beschwerlichen Erz-Abbau
Seit 2014 ist das SMAC eine feste Institution in der Chemnitzer Museumslandschaft. Überaus anschaulich zeigt es die Entwicklung der Erde sowie der Menschheit über tausende, ja sogar Millionen von Jahren. Höchste Zeit also, dass im Rahmen einer Sonderausstellung die Geschichte des Erzgebirges thematisiert wird. In der vierten Etage des Kaufhaus Schocken am Stefan-Heym-Platz lassen sich in verschiedenen Segmenten die letzten Jahrhunderte erkunden.
Den Beginn markieren neben zahlreichen farbenfrohen Mineralien historische Dokumente und Kunstwerke. Darin zeigen sich die vielfältigen Intentionen der Menschen, um überhaupt mit dem Bergbau zu beginnen. Waren es im 13. Jahrhundert, als in Freiberg das erste große „Berggeschrey“ seinen Lauf nahm, vor allem die ungewöhnlichen, glitzernden Rohstoffe. So erkannten die Einwohnenden schnell den praktischen Nutzen von Metallen für Werkzeuge, Waffen und als Zahlungsmittel.
Besonders eindrücklich waren für mich die einfachen Mittel, mit denen die Bergmänner und ‑frauen das kostbare Gut abbauten. Etwa mit einer simplen Keule. Per Feuersetzen wurde besonders hartes Gestein „mürbe“ gemacht. Weich war der Berg dann trotzdem nicht. Ein:e Arbeiter:in schaffte etwa einen Zentimeter Weg pro Arbeitstag. Zugleich war Arbeitsschutz ein Fremdwort. Ohne Schutz für Gliedmaßen und Organe schufteten die Menschen teilweise sieben Tage der Woche.
Mit großen Schaufelrädern wurden die Schächte und Stollen mit Frischluft versorgt. Ferner erkannten die Kumpel schnell, dass das Grundwasser aus dem Stollen befördert werden muss, um ein ungewolltes Fluten zu verhindern. Dafür kamen im 18. Jahrhundert auch erste Dampfmaschinen zum Einsatz, die als Pumpe fungierten. Übrigens mehr als 50 Jahre früher als sie James Watt einsetzte.
Vom verklumpten Erz über reines Metall zu prunkvollem Schmuck
Das geschürfte Erz musste anschließend physikalisch durch Mahlen von wertlosem Gestein und Mineralen, Gangart genannt, gereinigt werden. Es folgt die Anreicherung zu Erzkonzentrat. Beim Prozess des Verhüttens verändert das Material durch thermische Energie seinen Aggregatzustand zu flüssig, Schlacke entsteht. So wurden im Erzgebirge vor allem die Metalle Silber, Blei und Zinn, aber auch Eisen und Kupfer gewonnen.
Einen besonders großen Anteil an der Entwicklung der Veredlungs-Verfahren hat Georg Bauer, besser bekannt unter seinem lateinischen Namen Georgius Agricola. Der Arzt, Apotheker und Wissenschaftler aus dem 16. Jahrhundert gilt als „Vater der Mineralogie“ und Begründer der modernen Geologie. Nach Studien-Aufenthalten in Bologna, Padua und Venedig wurde er Apotheker in St. Joachimsthal, Arzt in Chemnitz und Bürgermeister in eben jener Stadt. Auch in der Sonderausstellung nimmt der Universalgelehrte einen Bereich ein. Seine wertvollen Schriften liegen unter einer unscheinbaren Vitrine.
Mit dem Bergbau erlangte auch Sachsen, damals unter Herrschaft der Wettiner, zu Reichtum. Das Land feierte seine Bergleute und widmete ihnen prunkvolle Berg- und Hüttenparaden. Diese sollten Volksnähe ausstrahlen und für öffentliche Sichtbarkeit sorgen. Noch heute sind die Berg- und Hüttenparaden hierzulande im Erzgebirge eine penibel gehegte Tradition. Innerhalb der Ausstellung werden fein geschnitzte Modelle, aber auch Schmuck und Portraits präsentiert. Eine eigene Ecke wurde auch der Religiosität gewidmet. Die vom harten und gefährlichen Alltag geprägten Bergmänner- und frauen sorgten für ein Aufleben der Spiritualität in der Region. Hierfür wurden große Hallenkirchen zentrumsnah in den Planstädten wie Annaberg-Buchholz oder Marienberg errichtet. Der Glaube gab den im Berg arbeitenden auch psychische Kraft, um die strapaziöse Arbeit unter Tage meistern zu können.
Der Schatten des Bergbaus in der DDR-Zeit
Apropos psychische Kraft. Ein kleiner Bereich der Ausstellung beleuchtet die Entwicklung des Bergbaus zur Zeit der „Deutschen Demokratischen Republik“ (kurz DDR). Nach dem Abwurf der Atombombe auf Hiroshima und Nagasaki, wurde auch in Ostdeutschland verstärkt nach radioaktivem Material gesucht. Denn die damalige Sowjetunion hatte keine solcher Waffen vorzuweisen. Unter dem Decknamen der „Wismut AG“, einem glänzend silberweißem Metall, entstand ein „Staat im Staat“ mit eigener Verwaltung und außerordentlichen Sonderrechten. Er wandte sich vor allem der Uran-Förderung im Erzgebirge zu.
Bis 1953 wuchs die Zahl der Mitarbeitenden auf 153.000 an. Aufgrund der guten Entlohnung und außerordentlichen Versorgung galt die „Wismut“ als attraktiver Arbeitgeber. So erblickte auch der namensgebende Schnaps „Kumpeltod“ das Licht der Welt. Der Name war jedoch auch unter Tage Programm. Denn die Risiken des Abbaus wurden verschwiegen. In den 46 Jahren wurden in der gesamten DDR insgesamt 216.300 Tonnen Uran gefördert.
Damit spannt die Sonderausstellung den Bogen zum stiefmütterlich behandelten Thema Arbeitsschutz. In den Jahrhunderten des Bergbaus wurde nie eine zufriedenstellendes Level an Arbeitssicherheit erreicht. Silkose und der strahleninduzierte Lungenkrebs waren Hauptkrankheitsbilder. Besonders eindrucksvoll empfand ich die Aufbereitung martialischer Ausrüstung, die jedoch nur selten richtig getragen und genutzt wurde. Beim Lesen von Schildern mit zu verwendenden Klopfzeichen im Falle einer Verschüttung stockte der Atem.
Bergbau im Erzgebirge – was bleibt?
Schön, dass sich „Silberglanz und Kumpeltod“ mit den Folgen des Erz-Bergbaus auseinandersetzt. Genauer gesagt mit dem Oberberghauptmann Hans Carl von Carlowitz, der von 1645 bis 1714 lebte. Er gilt als der Schöpfer des forstwirtschaftlichen Nachhaltigkeitsbegriffs. Denn sowohl für die Errichtung der Stollen als auch für den energieintensiven Betrieb der selben, wurden Millionen an Festmeter Holz abgebaut. Hinzu kam das Bevölkerungs- und damit das Städtewachstum, das für eine „Holznot“ sorgte. Er kritisierte den kurzfristigen Raubbau der Wälder und forderte als erster Mensch den pfleglichen Umgang mit der Natur. Seine Grundsätze haben bis heute Bestand.
Doch wie geht es mit dem Bergbau im Erzgebirge weiter? Aktuell werden in 400 Meter Tiefe in Pöhla bei Schwarzenberg wieder Wolfram und Fluorid abgebaut. Zudem soll zukünftig in Zinnwald das für Batterien so dringend benötigte Lithium abgebaut werden. Anders als früher steht heute der umweltbewusste Abbau im Fokus. Die Sonderausstellung „Silberglanz und Kumpeltod im SMAC Chemnitz endet mit überaus interessanten Karten zu den aktuellen Vorkommen von Metallen im Erzgebirge.
Noch bis zum 28. Juni kann sich jede:r ein Bild von der Geschichte und der Entwicklung des Bergbaus im Erzgebirge machen. Der Eintrittspreis liegt bei fairen 9 Euro. Mein Tipp: Samstag um 15 Uhr gibt’s eine kostenlose Führung mit weiteren spannenden Fakten. In diesem Sinne: Glück auf!
Entdecke mehr von Jonas’ Blog
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E‑Mail zu erhalten.