Chemnitz kann kritische Kunst. Bereits zum 22. Mal lädt das Kunstfestival Begehungen mit kreativen Installationen in ein altes, ungenutztes Gelände innerhalb des Stadtgebietes ein. Im Kulturhauptstadtjahr haben Künstler:innen aus der ganzen Welt das ehemalige Heizkraftwerk Nord in ein überdimensionales Kunstwerk verwandelt. Ich war auf dem Areal rund um den farbenfrohen Schornstein, liebevoll Lulatsch genannt, mit der Kamera unterwegs.
Ein altes Heizkraftwerk als Symbol des Wandels
Nachdem das Kunstfestival Begehungen in einer alten Kaufhalle, einer ehemaligen Schule, aber auch in einer grünen Kleingartensiedlung und einer stillgelegten Brauerei Heimat fand, fiel die Wahl im Kulturhauptstadtjahr auf das abgeschaltete Heizkraftwerk Nord im Stadtteil Furth. Ab 1957 wurde der Komplex sowohl für die Strom- als auch für die Fernwärmeversorgung genutzt. Mit dem Errichten der sozialistischen Plattenbaugebiete stieg der Bedarf rasant, sodass in der maximalen Ausbaustufe drei Blöcke mit jeweils 160 Megawatt Wärmeabgabe und 60 Megawatt elektrischer Leistung zur Verfügung standen. Als Energieträger fand in den Blöcken B und C Braunkohle Verwendung, während Block A auch mit Erdgas und leichtem Heizöl betrieben werden konnte.
Um die Anwohnenden zu schonen, galt es die Rauchgase auf möglichst verträgliche Weise abzuleiten. Zwischen 1979 und 1984 wurde deshalb auf dem Gelände ein 302 Meter hoher Schornstein gebaut. Dabei bedachten die Ingenieur:innen nicht, dass sich Stickstoff- und Schwefeldioxide im Regenwasser lösten und den sogenannten „Sauren Regen“ verursachten. Erst im Jahr 1995 schaffte eine Rauchgasentschwefelungsanlage Abhilfe. Lange Zeit fristete der Lulatsch, wie er von den Einheimischen genannt wird, sein Dasein als hässliches Entlein. Bis der französische Künstler Daniel Buren im Jahr 2013 einen neuen Farbanstrich verpasste. Eins Energie in Sachsen bezeichnet es als das höchste Kunstwerk der Welt. Nachprüfen lässt sich das schwer. Zumindest ist es bis heute das höchste Bauwerk in Sachsen.
Aufgrund der hohen Schadstoffemissionen von eine Million Tonnen CO2 pro Jahr schaltete der Betreiber das Heizkraftwerk Nord am 18. Januar 2024 vollständig ab. Es war der größte Emittent des klimaschädlichen Gases in der Region. Seitdem kommen Gaskraftwerke zum Einsatz, die den CO2-Ausstoß um 60 Prozent verringern. Seitdem liegt das Gelände zwischen Chemnitztal- und Blankenburgstraße Brach. Mit dem Kunstfestival Begehungen zieht nun wieder Leben in die industriellen Hallen ein.
Klimawandel und Raubbau an Natur und Mensch als Motto
Die Wahl des ehemaligen Gebäudekomplexes zur Erzeugung für Wärme und Energie kommt nicht von ungefähr. Zwar ist der Eigentümer Eins Energie in Sachsen einer der goldenen Sponsoren des Kulturhauptstadtjahres. Jedoch bildet das Heizkraftwerk mit seiner klimaschädlichen Vorgeschichte einen grandiosen Rahmen für die kostenfreie Ausstellung mit dem treffenden Titel „Everything is Interaction“ (zu deutsch: Alles ist Wechselwirkung). Das Zitat geht auf den Naturforscher Alexander von Humboldt zurück, der auf seiner Amerika-Reise zwischen 1799 und 1804 menschengemachten Holz- und Wassermangel beobachtete.
Die humboldtsche Erkenntnis der Wechselwirkungen in der Natur lässt sich schon damals weit über den Naturbegriff hinaus anwenden. Etwa auf die systematischen Ausbeutungsstrukturen, auf Armut auf der einen und Reichtum auf der anderen Seite. Auf einer Fläche von einem Hektar beleuchten in 32 Werken Kunstschaffende komplexe Themenstellungen wie Ressourcenverbrauch, Artenverlust und Klimakrise. Aber auch Gerechtigkeits- und Machtfragen und der damit verbundene gesellschaftliche Zwiespalt werden thematisiert.

Audio-visuelle Kunstwerke lassen die Gedanken wandern
Direkt zu Beginn der Ausstellung versetzt die deutsch-japanische Filmemacherin Hito Steyerl innerhalb einer der Deionatbehälter in Erstaunen. Sie lässt in ihrem Werk „Green Screen“ in Bierkästen lebende Pflanzen ‚sprechen‘, indem sie bioelektrische Signale in Licht und Ton verwandelt. Ein ebenso beeindruckendes Erlebnis wie das der Deutsch-Koreanerin Anne Dun Lee Jordan. Sie entführt uns Besucher:innen in die Tiefen des Ozeans mit überdimensionalen Silhouetten von Phytoplankton auf transluzenten Stoffbahnen. Dazu gesellen sich dumpfe Töne von Walgesängen, Atemgeräuschen und Motorbooten.
In den großen Hallen des Heizkraftwerk Nord lassen sich zahlreiche kleine Werke finden. Besonders eindrucksvoll ist die Gutenberg-Presse „Hoax Print“ des Slowaken Borek Brindák. Er veranschaulicht die gefährliche Entwicklung hin zur Desinformation. Besonders wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse zum Klimawandel werden online durch Falschinformationen untergraben. Nebenan lässt sich der energiespendende Brennstoff Kohle in Form des strukturierten Werks „Kula: Cuts“ von Nadia Kaabi-Linke betrachten. Das Wort Kula verweist zudem auf ein zeremonielles Tauschsystem der Trobriand-Inseln, das auf nachhaltigem Austausch und sozialer Bindung basiert.
Über allem hängen überdimensionale Tetrapoden der Künstler Abie Franklin und Daniel Hölzl unter dem Titel „Bycatch“. Eigentlich Wellenbrecher aus Beton, erscheinen die luftgefüllten Hüllen schwerelos unter dem Hallendach. Sie stehen für die ökologischen und politischen Grenzen unserer Zeit: für den Versuch, Natur zu kontrollieren und sie dennoch nicht bändigen zu können. Gleichzeitig thematisiert das Werk den unbeabsichtigten Beifang des industriellen Fischfangs. Eines meiner Highlights dieser Halle ist die Installation „Pech und Blende“ der Venezuelanischen Künstlerin Ana Alenso. Zwei Original-Bohrhämmer aus der Grube in Schlema stehen sich frontal gegenüber. An der Spitze zwei Gewehrpatronen. Eine eindrucksvolle Visualisierung geopolitischer Konflikte in Hinblick auf Ressourcensicherung, Machtpolitik und militärischer Strategie.
Menschengemachte Tragödien in Flora und Fauna lassen erschaudern
In der Halle nebenan regen Werke über den Einfluss des Menschen auf die Umwelt zum Nachdenken an. Unweit des Rolltors hängt an einem Kran die Installation „Rompiendo el Mar (Broken Sea)“ der mallorquinischen Künstlerin Amparo Sard. Es basiert auf aus dem Mittelmeer geborgenen Plastikmüll, den sie einschmolz und mit Epoxidharz verband. Ergebnis ist ein schwarzer Stein, der für eine Natur im Kollaps steht. Das Innehalten wird gestört von ebensolchen Klängen, die durch die Halle schallen. Sie gehören zum Werk „The Carrion Cheer, A Faunistic Tragedy“ des Künstler-Duos Böhler & Orendt. Dabei handelt es sich um ein imaginäres Camp, in dem neun Abbilder ausgestorbener Tiere erscheinen. Die geisterhaften Projektionen richten sich mit schaurigen Gesängen an die Menschheit. Angsteinflößend.
Die Österreicherin Katharina Sauermann hält der autoliebenden, deutschen Gesellschaft den Spiegel vor. Ihre Komposition „Die Luftqualität ist schlechter als gestern zu dieser Zeit“ macht die verborgene Präsenz von Feinstaub sichtbar. Aus dem Stuttgarter Stadtraum hat sie den Schadstoff sedimentieren lassen und so Umweltverschmutzung sinnlich erfahrbar gemacht. Nicht weniger bedrückend ist die 3‑Kanal-Videoinstallation „Stork, a Sacket Bird“ der polnischen Künstlerin und Forscherin Diana Lelonek. Sie begleitet eine Weißstorchpopulation auf der größten Mülldeponie des Ostseeraums Getliņi bei Riga. Die Tiere werden ungefragt Teil eines Systems aus Abfall, Konsum und Umweltzerstörung. Bedrückend.
Noch einen Schritt weiter geht die ukrainische Künstlerin Elza Gubanova. Sie stellt in „Notes on Ecocide“ die ökologischen und juristischen Dimensionen kriegsbedingter Umweltzerstörung in den Mittelpunkt. Die dokumentarische und forschungsbasierte multimediale Installation zeigt, ausgehend von der Zerstörung des Kachowka-Staudamms in der Ukraine, wie Landschaften durch Gewalt geprägt werden. Schön, dass Uriel Orlow in „Forest Futurist“ die Chancen und Möglichkeiten des Waldes beleuchtet. Er lädt ein den Wald als lebendigen Wissensspeicher neu zu denken. Etwa in Form von abstrakten Musikinstrumenten.
Plätschernde Wasserspiele und Signale aus der Meerestiefe lassen inne halten
Nach all den oberirdischen Themen stellen Künstler:innen in der abgedunkelten Nebenhalle das Wasser in den Mittelpunkt. Raumgreifend ragt im hinteren Teil die Mixmedia-Installation „Lluvia“ des kolumbianischen Kreativen Daniel Otero Torres empor. Er rückt die ökologischen und sozialen Folgen des illegalen Goldabbaus im kolumbianischen Amazonasgebiet ins Zentrum der Betrachtung. Sachte plätschert Wasser aus sechs Meter Höhe über mehrere Stationen herab. Auf seinem Weg durchfließt es blaue Tonnen. Sie stehen für die quecksilberhaltigen Rückstände aus den gewinnbringenden Minen. Trotz hoher Niederschlagsmengen ist der Zugang zu sauberem Trinkwasser dort stark eingeschränkt. Das Werk zeigt einmal mehr die strukturelle Ungleichverteilung lebenswichtiger Ressourcen und stellt eine Verbindung zu kultureller Identität und ökonomischen Interessen her.
Nebenan entführt die Komposition „The Archive of the Arctic Echoes“ der niederländischen Künstlerin Sarah Damai Hoogman in die Tiefen des arktischen Ozeans. Sie macht die unsichtbare, aber dringliche Umweltveränderungen in Form von realen Klängen von Methanblasen erfahrbar. Kleine LEDs offenbaren den Ort der Aufnahme. Es entsteht eine rhythmische Klanglandschaft, die durch sensorische Interaktion mit dem Publikum differiert. Rückkopplungseffekte zwischen menschlicher Aktivität und Umweltveränderung werden so erlebbar.
Dieser Einfluss zeigt sich auch in den beiden Kunstwerken „Virgins Land“ und „Shape of the Shore“ von Johanna Reich. Wie eine Fahne weht die goldene Rettungsdecke in den Händen der Künstlerin an einer scheinbar unberührten Küste. Doch die ist längst durch menschliche Eingriffe gezeichnet – nicht zuletzt durch globale Emissionen. Die werden in den fotografischen Überlagerungen sichtbar. Auf Basis von Daten der Organisation Climate Central hat Reich die aktuellen und zukünftigen Küstenlinien überlagert. In Hinblick dessen bekommt auch die Rettungsdecke eine weitere Bedeutungsebene. Sie fungiert als schillerndes Symbol von Verlust und Verletzlichkeit.
Begehungen macht die Magie der Luft in Bild und Ton erlebbar
An der Außenseite des beeindruckenden Reaktorgebäudes, zwischen den Treppenaufgängen hin zum Dach, hat der Japaner Rikuo Ueda seine Arbeit „A Letter from the Wind“ installiert. An Fäden und Stäben montierte Stifte hinterlassen durch Windbewegungen zeichnerische Spuren, die zur Interpretation einladen. Sie sind unvorhersehbar als auch einzigartig und machen die Kräfte der Natur sichtbar. Schön, dass wir Menschen Methoden gefunden haben, diese umweltfreundlichen Energien sinnvoll zu nutzen.
Die kleine Entdeckungstour durch das Heizkraftwerk Nord gipfelt in der Begehung des wuchtigen Kühlturm 1 im Norden des Geländes. Die große Wand wirkt wie ein großer Resonanzraum, der jeden Ton verstärkt und als Echo zurück wirft. Natürlich beherbergt er deshalb eine beeindruckende Klanginstallation. Mit ihrer Installation „Aura Dissipation“ verwandelt das italienische Künstler-Duo Valeria Zane und Victor Nebbiolo di Castri den Raum in ein akustisches Erlebnisfeld. Auf dem Boden platzierte Lautsprecher senden elektroakustisch verfremdete Harfenklänge in die Weite des überdimensionierten Hallraums, wo sich jede Schwingung mit der Architektur verbindet.
Ein würdiger Abschluss für ein Kunstfestival, das erneut beweist, wie stark die Verbindung von Ort und inhaltlicher Auseinandersetzung sein kann. Noch bis zum 17. August gibt es zwischen 12 und 20 Uhr die Gelegenheit die Symbiose zwischen Heizkraftwerk und Installationen selbst zu erleben.
Entdecke mehr von Jonas’ Blog
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E‑Mail zu erhalten.
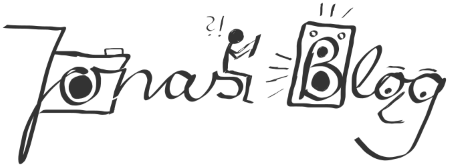






































[…] in Chemnitz: Bedenkenswerte Begehungen im Heizkraftwerk Nord (das mit dem bunten […]